- Zeckenabwehr für Pferde: Natürlich, biologisch & wirksam gegen Zecken? - 19. Mai 2021
- Knoblauch gegen Wespen & Fliegen im Test | Mit Knoblauch Wespen vertreiben? - 9. September 2020
- Tomaten gegen Wespen im Test | Vertreiben Tomaten Wespen? - 7. September 2020
Zecken haben einen schweren Stand.
Keiner will sie. Keiner mag sie.
Raubtiere werden hochgeachtet, obwohl sie gezielt andere Wesen umbringen (z. B. Eulen, Adler, Katzen, Löwen, Bären usw.).
Doch Zecken und andere Parasiten, die eigentlich nur ein bisschen Blut saugen, werden zutiefst verachtet und verabscheut.
Schutzkleidung gegen Zecken:
 |
 |
| Anti-Zecken-Socken | Safersox | Anti-Zecken-Hose | Craghoppers |
| Angebot bei Amazon | Angebot bei Amazon |
| Angebote bei eBay | Angebote bei eBay |

Inhaltsverzeichnis
Abscheu gegen Parasiten verstehen
Die Abscheu gegenüber Parasiten lässt sich aus folgenden Gründen erklären:
- Der Mensch ist als Opfer direkt betroffen – anders als bei den meisten Raubtieren.
- Parasiten werden mit mangelnder Sauberkeit/Hygiene verbunden (z. B. Läuse, Bettwanzen, Krätze-Milben).
- Viele Parasiten saugen Blut, verletzen dabei die Haut und verursachen unangenehmen Juckreiz.
- Einige Parasiten übertragen gefährliche Krankheiten und zählen damit zu den tödlichsten Gefahren für den Menschen (z. B. Tsetsefliege, Tigermücke, Malariamücke).
- Die Vorstellung von Parasiten, die im Körper leben, ist extrem unangenehm (z. B. Bandwürmer).
Dies sind sicher nur einige Gründe und vielleicht ist die Abscheu gegenüber Parasiten bereits in den Genen verankert.
Denn Milben, Läuse und Zecken begleiten den Menschen und seine Vorfahren bereits seit Millionen von Jahren.
Gegenbeispiele sind die Ausnahme.
Flöhe werden zum Beispiel in einigen Kulturen als Glücksbringer angesehen.
Doch die meisten Parasiten zählen zu den verhasstesten Lebewesen auf der Erde.
Sie werden vergiftet, vergast und in tödliche Fallen gelockt.

Die meist-gehassten Lebewesen
Wenn man nach den ausgestoßensten Wesen auf dem Planeten sucht, dann wird man bei Zecken, Wanzen, Milben und Läusen fündig.
Die Ehrfurcht vor dem Leben ist ein hohes Ziel und in vielen Gesetzen verankert, doch bei Parasiten und Schädlingen hört sie ganz schnell auf.
Zwar beginnen die Gesellschaften damit, mehr und mehr Tieren ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zuzusprechen.
Zum Beispiel, wenn eine kleine Robbe für ihr Fell zu Tode geprügelt wird, dann begehren einige Menschen auf.
Auch wenn Eisbären der Lebensraum schwindet, gehen die Menschen protestieren und unterzeichnen fleißig Petitionen.
Doch Unterschriftenaktionen oder Demonstrationen für Zecken, Läusen und Milben sind eher eine Seltenheit.
Wer Zecken ein Recht auf Leben zuspricht, wird schnell für verrückt erklärt oder als weltfremd belächelt – wenn nicht verachtet.
Es gibt schlicht keine „guten“ Argumente für das Töten von Parasiten.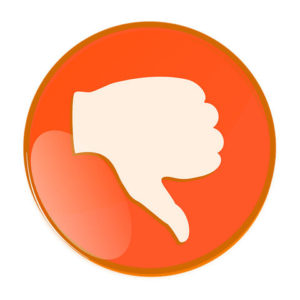
Denn als „Schädlinge“ verursachen sie schließlich einen Schaden und das müssen sie meist mit ihrem Leben bezahlen.
Argumente, die gegen das Töten sprechen, werden dabei schnell vergessen oder vernachlässigt.
Argumente gegen das Töten von Zecken
Es gibt jedoch auch eine ganze Reihe von Argumenten, die dafür sprechen, nicht alle Parasiten zu töten.
Doch sie sind schwerer zu finden als die Argumente, die dafür sprechen.
Deshalb werden einige nun beleuchtet – am Beispiel von Zecken.
 Nutzen von Zecken für den Menschen
Nutzen von Zecken für den Menschen
Zecken unterstützen die Immunabwehr.
Immer mehr Menschen leiden an Autoimmunerkrankungen und dies wird auch damit erklärt, dass das Immunsystem zu wenig zu tun hat.
Eine Zecke ist eine kleine Herausforderung für die körpereigenen Abwehrzellen und schadet einem gesunden Immunsystem nicht – im Gegenteil:
„Was nicht tötet, härtet ab!“
Davon abgesehen ist der Speichel von Zecken angefüllt mit Substanzen, die dazu taugen, medizinisch bedeutsam zu werden.
In Brasilien haben Forscher Hinweise darauf gefunden, dass im Zeckenspeichel Heilmittel gegen Krebs vorkommen.
Video: Zeckenspeichel bekämpft Krebszellen
Nutzen von Zecken in der Natur
Zecken sind zudem für viele Tiere eine Nahrungsquelle.
Siehe hier: Liste mit natürlichen Feinden von Zecken.
Tötet man Zecken, dann schadet man auch ihren natürlichen Feinden (z. B. Vögeln) und verhindert, dass ökologische Gleichgewichte entstehen können.
Es gibt sogar eine Erzwespe, die ohne Zecken nicht überleben könnte; denn sie legt ihre Eier in die Körper vollgesogener Zeckenweibchen.
Darüber hinaus stabilisieren Parasiten Ökosysteme und fördern die Evolution der Arten.

Töten von Zecken ist unnötig
Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich vorbeugend gegen Zecken zu schützen.
Wenn man Zecken wirksam abwehren kann, gibt es keinen Anlass mehr, sie zu töten.
Hier findet man eine Übersicht über zeckenabweisende Mittel und Wirkstoffe.
Und hier mehr Informationen über Zeckenabweisende Kleidung: Socken, Hosen und Jacken, die gegen Zecken schützen.
Schutzkleidung gegen Zecken:
 |
 |
| Anti-Zecken-Hemd | Craghoppers | Zecken-Schutz-Jacke | Rovince |
| Angebot bei Amazon | Angebot bei Amazon |
| Angebote bei eBay | Angebote bei eBay |
Töten stumpf Menschen ab
Wer das Töten im Kleinen rechtfertigt und durchführt, kann mit der Zeit die Ehrfurcht vor dem Leben verlieren.
Denn durch das Töten von Lebewesen verroht der Mensch und verliert seine natürliche Unschuld.
Im ersten Paragrafen des Tierschutzgesetzes heißt es:
„Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ § 1 TierSchG
Letztlich muss man sich, bevor man Tiere tötet, also die Fragen stellen:
Gibt es einen vernünftigen Grund, diesem Tier zu schaden?
Oder geschieht es nur aus Unvernunft heraus?
Gibt es vielleicht vernünftigere Wege, mit einem „Schädling“ umzugehen?
Hat nicht auch er ein Recht auf Leben, vielleicht weil er nützlich ist?
Diese Fragen muss schließlich nicht nur jeder für sich beantworten, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes muss sich fragen, wem sie ein Recht auf Leben zuspricht und wem nicht.
Es gab in Deutschland eine Zeit, in der von „unwertem Leben“ ganz offen gesprochen wurde.
Diese Zeiten sind zwar vorbei, doch gehandelt wird nach dieser Annahme immer noch.
Das wird deutlich, wenn man sich mit Tierzucht beschäftigt.
Ich bin mir sicher, dass eine Zeit kommen wird, in der auch wirbellosen Tieren ein Recht auf Leben zugesprochen wird.
Denn das Mitgefühl in Gesellschaften nimmt immer mehr zu.
Immer mehr Menschen erkennen, dass es nicht nötig ist, Tieren Leid zuzufügen, um zu überleben und genug zum Essen zu haben.
Die Idee, sich nur von Pflanzen zu ernähren, ist Jahrtausende alt, doch noch nie war es so leicht wie jetzt.

Übung in Mitgefühl
Zecken am Leben zu lassen, ist eine wundervolle Übung in Mitgefühl.
Zeckenhilfe ist auch deshalb entstanden, weil buddhistische Nonnen, Mönche und Laien vor einem Dilemma stehen.
Auch sie leiden ab und zu unter Zeckenbissen, Flöhen, Grasmilben, etc.
Auch sie haben Angst, sich mit Borreliose-Bakterien zu infizieren.
Gleichzeitig üben sich Mönche und Nonnen darin, alle Lebewesen zu schützen.
Sie versuchen, allen Lebewesen zu nützen und möglichst keinem Lebewesen zu schaden.

Daher versuchen einige Buddhisten, folgende ‚Achtsamkeitsübung‘ zu praktizieren:
„Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl und Einsicht in das „Intersein“ zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Ich bin entschlossen, nicht zu töten, es nicht zuzulassen, dass andere töten, und keine Form des Tötens zu unterstützen, weder in der Welt noch in meinem Denken oder in meiner Lebensweise. Im Wissen, dass schädliche Handlungen aus Ärger, Angst, Gier und Intoleranz entstehen, die ihrerseits dualistischem und diskriminierendem Denken entspringen, werde ich mich in Unvoreingenommenheit und Nicht-Festhalten an Ansichten üben, um Gewalt, Fanatismus und Dogmatismus in mir selbst und in der Welt zu transformieren.“
Dies ist die erste Achtsamkeitsübung „Ehrfurcht vor dem Leben“ – entwickelt von Thich Nhat Hanh.
Darin finden sich sehr hohe Ziele, die in der Praxis (fast) unmöglich umsetzbar sind – das wissen auch die Nonnen und Mönche.
Dennoch ist es ihre tiefe Absicht, das Leben von Tieren und Pflanzen zu schützen und keine Form des Tötens zu unterstützen.
Für mich persönlich waren Zecken, die letzten Tiere, die ich absichtlich getötet habe.
Doch dann habe ich eine Weile im Achtsamkeitspraxis-Zentrum Plum Village gelebt – einem Zen-Kloster in Frankreich.
Dort ist mir bewusst geworden, dass auch Zecken ein Recht auf Leben haben – wahrscheinlich spüren auch sie Schmerz und Leid.
Schließlich habe ich mich deshalb dazu entschlossen, auch Zecken nicht mehr zu töten.
Stattdessen habe ich begonnen, sie nach dem Entfernen an einen entlegenen Ort zu bringen, an dem möglichst nie andere Menschen vorbeikommen.
Dieser Geisteswandel war für mich ein Quell der Freude.
Denn Töten der Zecken war für mich meist eher das Gegenteil.
Entlegene Orte entdecken
Zecken nach dem Entfernen wieder in der Natur auszusetzen, erscheint zunächst etwas verrückt – folgt jedoch einer gewissen Logik mit Konsequenz.
Man benötigt zwar ein bisschen Zeit, um einen passenden Ort zu finden, doch dafür wird man manchmal auch belohnt.
Denn man entdeckt dabei unberührte Plätze, an denen normalerweise kein Mensch vorbeikommt.
Diese Orte sind – wenn man Glück hat – wunderschön.
 Fazit
Fazit
Es gibt sicher einige Gründe dafür, Zecken nach dem Entfernen zu töten.
Doch es gibt genauso Argumente, die dagegen sprechen.
Letztlich stellt sich auch hier die Frage, welche Werte und Lebensweisen möchte man in seinem Leben kultivieren.
Der einfache Weg ist es, Zecken die Toilette oder im Waschbecken herunterzuspülen.
Doch es kann viel schöner sein, ihnen einen abgeschiedenen Platz zu suchen und dabei die Natur neu zu entdecken.
Schließlich könnte der Weg dahin führen, dass man sich durch wirksame zeckenabweisende Mittel von vornherein gegen Zeckenbisse schützt.
Dann könnte eine Zeit anbrechen, in der Zecken und Menschen getrennte Wege gehen.
Vielleicht gelingt es auf diese Weise, friedlich nebeneinander zu existieren – ohne einander zu schaden.
Natürlicher Zeckenschutz für Haustiere
 |
 |
| Zeckenschutz für Hunde | Natürliche Zeckenabwehr für Pferde. |
Für Katzenliebhaber hier eine Übersicht über: Biologische Mittel gegen Zecken bei Katzen.
Zeckenabwehr für Tiere
 |
 |
| Schwarzkümmelöl für Pferde und Hunde | 1.000 ml | Bierhefe für Haustiere | Auch für Katzen |
| Angebote bei Amazon | Angebote bei Amazon |
| Angebote bei eBay | Angebote bei eBay |
Wie man sich gegen Zecken schützen kann:
 |
 |
Zeckenschutz für Mensch und Tier
 |
 |
| Mit Schwarzkümmelöl gegen Zecken | Zeckenschutz-Spray | Multi-Insect mit Icaridin |
| Angebot bei Amazon | Angebot bei Amazon |
| Angebote bei eBay | Angebote bei eBay |
 |
 |
| Nobite Insektenschutz | Imprägnierung von Kleidung | Einfache Zeckenentfernung mit Zeckenschlinge |
| Angebot bei Amazon | Angebot bei Amazon |
| Angebote bei eBay | Angebote bei eBay |
Achtsamer Konsum: Bitte kaufen Sie nur, was Sie oder Ihre Tiere wirklich brauchen.
Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben?
Falls nicht, melden Sie sich bitte kurz per Mail oder Kommentar.
Dies unterstützt die Verbesserung der Informationen und die Ergänzung des Artikels.
Vielen Dank – auch fürs Teilen und für eine gute Bewertung.
Schön, dass Sie da sind!



 Nutzen von Zecken für den Menschen
Nutzen von Zecken für den Menschen
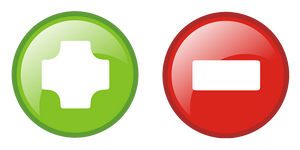 Fazit
Fazit